Drei Jahrzehnte lang diente die ausgediente alte Kirche von Wünnewil als Truppenlager, Turnhalle und Vereinslokal. Im barocken Kirchenschiff wurde Fussball und Theater gespielt, musiziert und gefeiert. 1968 sprengen Luftschutztruppen die alte Kirche. Augenzeugenberichte von Wünnewiler Schülern schildern die dramatischen Momente.
Ende September 1968 rückt die Kompanie 4 des Luftschutzbataillon 3 des Schweizer Militärs zu einem ganz besonderen Wiederholungskurs in Wünnewil ein. Die 85 Luftschutzsoldaten sollen die alte Wünnewiler Kirche aus dem Jahr 1776 sprengen. Seit der Einweihung der neuen Pfarrkirche im November 1933 wurde die alte Kirche nicht mehr als Gotteshaus genutzt, nach dem Zweiten Weltkrieg diente sie den Wünnewiler Vereinen als Turnhalle, Theatersaal und Vereinslokal.
Doch diese Ära geht nun zu Ende. Weil der Pfarrei das Geld für die Sanierung des maroden Kirchleins fehlt, muss das alte Gotteshaus weg (mehr dazu weiter unten). Die Lösung mit der Luftschutztruppe kommt die Pfarrei günstig zu stehen, damit spart sie sich die Abbruchkosten.


Die alte Kirche hatte das Wünnewiler Dorfbild seit Jahrhunderten geprägt und war vielen ans Herz gewachsen. Ihre Sprengung war deshalb ein einschneidendes Erlebnis, an das sich noch heute viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erinnern. Ein ganz besonderer Augenzeugenbericht ist im Wünnewiler Pfarreiarchiv überliefert. Es sind schriftliche Schilderungen von Schülern der 7. bis 9. Primarklasse von Wünnewil. Lehrer Oswald Schneuwly hatte seinen Schülern den Auftrag gegeben, die rund zweiwöchigen Abbrucharbeiten mit kurzen Aufsätzen zu dokumentieren.
Am 30. September rücken die Soldaten in Wünnewil ein und beziehen Quartier im Schulhaus, die Offiziere logieren im Gasthof St. Jakob. In den nächsten Tagen bereiten die Soldaten alles für die Sprengung des Kirchenschiffs am 3. Oktober vor. Am Vorabend passiert das Unerwartete, das Holzdach des Kirchenturms fängt Feuer und brennt ab:
«(…) trat gestern abend gegen 18.00 Uhr eine unvorhergesehene Wendung ein. Laut Plan sollte der Kirchturm etappenweise abgebrochen werden. Da bei den Räumungsarbeiten auch Balken verbrannt wurden, fing das Holzdach des Turms Feuer und brannte ab. Die Bevölkerung von Wünnewil und Umgebung kam somit in den Genuss eines einmaligen Schauspiels.»
Schüleraufsatz, Pfarreiarchiv Wünnewil
Trotz des Zwischenfalls wird am 3. Oktober 1968 das Kirchenschiff planmässsig gesprengt. Mit Hornsignalen wird die Bevölkerung gewarnt. In einem Umkreis von 200 Metern muss die Bevölkerung die Fenster öffnen, damit die Druckwelle sie nicht beschädigt. Die Fensterläden hingegen müssen geschlossen werden, um allfällige Trümmerteile abzuhalten.
«9.40 Uhr: Wir stehen 100 m von der alten Kirche. Mit Spannung schauen und warten wir. Die Schulkinder und viel Volk haben sich hier versammelt. Soldaten sperren die Strassen. Alle Fensterläden der umliegenden Häuser sind geschlossen. 9.46 Uhr. Boum! Die Erde zittert. Die Südfront hebt sich und stürzt ein. Der Dachstuhl bricht zusammen und donnert zu Boden. Eine dichte Staubwolke hüllt die Kirche ein. Soldaten springen an die Wendrohre und spritzen Wasser in die Trümmer.»
Schüleraufsatz, Pfarreiarchiv Wünnewil


Am 7. Oktober notiert ein Schüler:
«Wie nach einem Bombardement sieht die alte Kirche aus. (…) Balken und Steine liegen durcheinander. Die Räumung ist im vollen Gange. Mächtige Balken des Dachstuhls werden mit Motorsägen versägt. Ein Trax hebt die schweren Felsblöcke in Camions. Drei solche Lastwagen helfen dabei mit. Sie führen die Überreste in die Abfallgrube von Blumisberg.»
Schüleraufsatz, Pfarreiarchiv Wünnewil
Am 8. Oktober um 10 Uhr morgens wird schliesslich der Turm gesprengt. In den darauffolgenden Tagen räumen die Soldaten die Überreste weg.
«Der Schutt der alten Kirche wird nach Eggelried, Dietisberg und nach Blumisberg geführt.»
Schüleraufsatz, Pfarreiarchiv Wünnewil
Mitte Oktober rücken die Soldaten wieder ab. Die alte Kirche ist weg, die Trümmer weggeräumt.

Fussballspiel im Kirchenschiff – die weltliche Nutzung der alten Kirche
Wieso kam es überhaupt zur Sprengung der alten Kirche? 1932/33 baute die Pfarrei Wünnewil eine neue, grosse Kirche oben an der Dorfstrasse. Ursprünglich hätte die neue Kirche am Platz der alten errichtet werden sollen. Doch wenige Tage vor dem geplanten Spatenstich im September 1932 starb unerwartet Pfarrer Josef Schmutz, der als Spendensammler das finanzielle Fundament für den Kirchenbau gelegt und das Bauprojekt vorangetrieben hatte. Mit Schmutzs Tod nahm das Bauprojekt eine überraschende Wendung. Schmutzs Nachfolger Alfons Riedo setzte nämlich einen neuen Bauplatz an der Dorfstrasse durch, wo die neue Kirche zwischen März 1932 und November 1933 gebaut wurde.
Damit hatte Wünnewil zwei Kirchen – und keinen Plan, was mit dem alten Kirchlein geschehen sollte. Schon bald wurde der Barockbau für weltliche Zwecke genutzt. Während des Zweiten Weltkriegs waren Schweizer Soldaten und zeitweise auch internierte jugoslawische Soldaten in der Kirche untergebracht. Eine Zeit lang arbeitete ein Handwerker in der Kirche. 1946 baute der neu 1945 gegründete katholische Turnverein Wünnewil – mit dem Segen und finanzieller Unterstützung von Pfarrei und Gemeinde – die Kirche behelfsmässig in einen Turn- und Theatersaal um. In den nächsten zwei Jahrzehnten nutzten neben dem Turnverein auch andere Dorfvereine die Kirche für ihre Trainings und Proben, für Aufführungen, Theater, Konzerte und bunte Abende.
Die alte Kirche wurde zu einem Brennpunkt des sozialen Lebens in Wünnewil. Hier wurde geturnt, gefeiert, gelacht, getanzt und geflirtet. Beim Theaterspielen in der alten Kirche knüpften junge Frauen und Männer Beziehungen, die später vor den Traualtar führten. Jugendliche rauchten im Schutz der Friedhofmauer ihre ersten Zigaretten und nutzten den Estrich als Abenteuerspielplatz. Und die Deckengemälde des bedeutenden Barockmalers Gottfried Locher dienten besonders Übermütigen als Zielscheibe beim Fussballspielen.
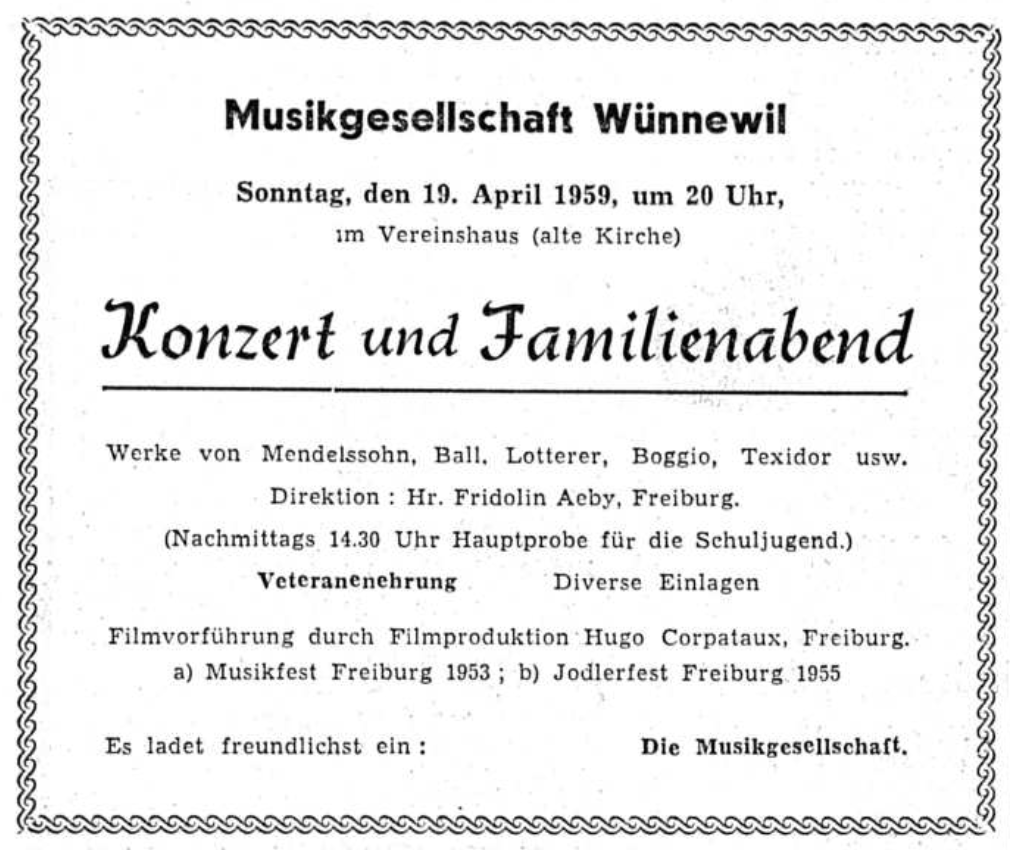
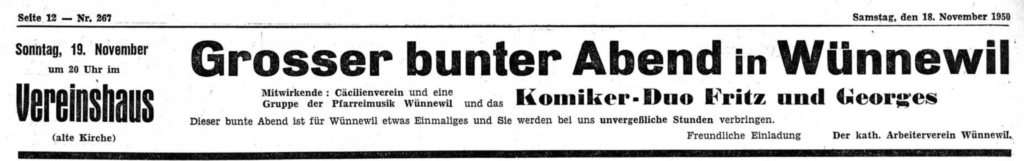
Restaurieren oder abreissen?
Diese Verweltlichung geschah aus der Not und Platzmangel heraus – und mit dem Einverständnis des Pfarreirates und der stillschweigenden Billigung der Wünnewilerinnen und Wünnewiler. Einen offiziellen Beschluss über die Nutzung der Kirche hatte die Pfarreiversammlung allerdings nie getroffen. Kirchenrechtlich sprach zwar nichts gegen die weltliche Nutzung, schliesslich war die alte Kirche offiziell entweiht (exsekriert) worden. Dennoch blieb bei Auswärtigen und Einheimischen ein zwiespältiges Gefühl. Immerhin war die Kirche weiterhin als Kirche erkennbar, im Turm schlug noch immer das Totenglöcklein und rund um die Kirche lag der Friedhof. Passte das weltliche Treiben wirklich in die alte Kirche?
Zudem war die alte Kirche baufällig geworden, eine Renovation war angezeigt. 1954 setzte die Pfarrei deshalb eine Kommission ein, die abklären sollte, was mit der alte Kirche geschehen sollte. Restaurieren oder abreissen?, lautete die Frage.
Am 13. März 1955 legte der Flamatter Arzt und Lokalhistoriker Peter Boschung der Pfarreiversammlung den Bericht der Studienkommission vor. Das Resultat war ernüchternd. Die alte Kirche sei zwar «schön in ihrer Einfachheit, ihrer Lage, ihrer Bedeutung im Dorfbild, aber sie ist weder geschichtlich, noch kunstgeschichtlich so bedeutend, dass sie um jeden Preis und jedes Opfer erhalten werden muss». Ein Umbau in ein «ideales Vereinshaus mit Turnsaal» wäre zwar technisch möglich, so die Kommission weiter, «wird aber nie ganz befriedigen, weder praktisch, noch gefühlsmässig». Vor allem würde ein Umbau sehr teuer zu stehen kommen, heisst es im Bericht weiter. Laut einem Gutachten des Schmittner Architekten August Aebischer hätte man dafür mit Kosten von 100’000 Franken rechnen müssen.
«Und das, werte Pfarreibürger, macht allen grundsätzlichen Diskussionen, ob wir die alte Kirche gegen unser Gefühl in ein Vereinshaus umbauen wollen, oder dürfen, ein Ende: Wir vermögen es einfach nicht!»
Peter Boschung, Bericht der Studienkommission für die alte Kirche zu Handen der Pfarreiversammlung
Die Pfarreiversammlung fällt das Todesurteil
Ein Umbau war also zu teuer. Die Kirche verfallen zu lassen, komme aber auch nicht in Frage, so Peter Boschung. «Die einzige saubere Lösung ist: sie abbrechen, auch wenn das für uns alle ein Verzicht und ein grosses Opfer verlangt.»
Konkret machte die Studienkommission der Pfarreiversammlung folgende Vorschläge:
- Die Pfarrei soll die alte Kirche in spätestens 10 Jahren abbrechen.
- Die Pfarrei gestattet den Pfarrvereinen in der Zwischenzeit die Benützung der alten Kirche als Turn-, Versammlungs- und Festsaal, so wie es in den letzten Jahren Brauch geworden ist (ohne Tanz!).
- Die Pfarrei sollte für die alte Kirche keine weiteren Auslagen machen, ausser was ganz dringend notwendig ist, z.B. was Sicherheit, Unfallverhütung und Wetterschutz verlangen.
- Die Pfarrei soll das Andenken an die alte Kirche in Form von Plänen, Photographien des Äusseren und der Kunstwerke (Deckenbilder, Kreuzigungsgruppe) dokumentarisch festhalten und im Pfarrarchiv sicherstellen.
Die Pfarreiversammlung vom 13. März stimmte den Vorschlägen der Studienkommission zu. «So wurde denn von der Versammlung das Todesurteil gesprochen, zögernd zwar und lange nicht alle fanden das Herz dazu. (…) manch einer hatte eine gewisse Angst vor dem kahlen, leeren Hügelchen am Dorfrande», berichteten die «Freiburger Nachrichten» am 5. April 1955.
Vollzogen wurde das Todesurteil dann nicht bereits wie geplant 1965, sondern erst 1968. In diesem Jahr war das Problem der Turnhalle und des Vereinslokals nämlich definitiv gelöst. Im Herbst 1968 war in Wünnewil das neue Schulhaus samt Turnhalle eingeweiht worden, zudem hatte der Pfarreigasthof St. Jakob in den 60er-Jahren einen grossen Saal bekommen, der für Konzerte und Aufführungen genutzt wurde.
Was von der alten Kirche übrig blieb
Was ist von der alten Kirche geblieben? Am Standort der alten Kirche (wo der Pfrundweg in die Schlösslistrasse mündet) erinnert heute lediglich ein Wegkreuz an das Kirchlein. Im Rasen auf dem Kirchhügel lassen sich die Umrisse der Fundamente noch erahnen (siehe Foto unten). Das Weihwasserbecken der alte Kirche hat auf dem Friedhof der neuen Kirche seine letzte Ruhestätte gefunden. Das einstige gusseiserne Turmkreuz ziert die Fassade der katholischen Kirche in Flamatt, der Wetterhahn wird im Dorfmuseum im alten Pfrundspeicher aufbewahrt.

Die barocken Deckengemälde Gottfried Lochers finden ein neues Zuhause
Von der ehmaligen Innenausstattung der Kirche wurden die barocken Deckengemälde des Freiburger Barockmalers Gottfried Locher (1735-1795) gerettet, die Locher 1775/76 gemalt hatte. Die grossen Gemälde (3,5 x 5,5 Meter und 3,5 x 2,7 Meter) hatten arg unter der weltlichen Nutzung der Kirche gelitten hatten. «An der verrussten Decke sind ungezählte Beweise der hinaufgeprellten Bälle, die offensichtlich die Deckenbilder als Ziel ersahen und dadurch selbstverständlich die Malereien arg in Mitleidenschaft zogen», schrieb 1967 Willy Zeller, der im Auftrag des Schweizerischen Heimatschutzes die Deckengemälde inspizierte.1
Die Deckengemälde wurden abgelöst und restauriert. Das Dreifaltigkeitsbild schenkte Wünnewil der Pfarrei Bösingen, wo es heute in der Pfarrkirche hängt. Das Bild der Heiligen Margaretha fand den Weg in die katholische Kirche von Kirchberg im Kanton St. Gallen. Das Bild «Mariäe Verkündigung» hätte ursprünglich in der 1973 eröffneten katholischen Kirche in Flamatt einen Platz finden sollen, passte aber nicht in den modernen Bau und wurde daher im Heizungskeller der Pfarrkirche Wünnewil eingemottet. Erst 2007 fand es an der Decke der Kirche von Altendorf im Kanton Schwyz eine neue Bestimmung (mehr dazu hier, S. 197 und folgende).
Ein Souvenir in Öl von Max Clément
Viele Wünnewilerinnen und Wünnewiler hingen an der alten Kirche von Wünnewil. Das machte sich auch der Sensler Kunstmaler Max Clément (1912-1995) zu Nutze, der im Mühletal bei Schmitten auf die Welt gekommen war. Kurz vor ihrem Abbruch malte er die alte Kirche von Wünnewil in verschiedenen Formaten und aus verschiedenen Perspektiven und verkaufte die Bilder in Wünnewil als Souvenir. Noch heute hängt wohl in mancher Stube ein derartiges Ölgemälde der alten Kirche von Wünnewil – vielleicht auch bei Ihnen?
Erinnern Sie sich noch?
Erinnern Sie sich noch an die alte Kirche und das Vereinsleben im Kirchenschiff? Haben Sie vielleicht noch Fotos von Veranstaltungen in der alten Kirche? Oder vielleicht sogar den Abbruch der Kirche mit einer Super-8-Kamera gefilmt? Ich freue mich sehr über jede Rückmeldung (meine Kontaktdaten finden Sie hier). Stephan Moser

Die neue und die alte Kirche auf einer gemeinsamen Aufnahme.
(Postkarte von W. Wiedmer Photo Bern, Privatbesitz)
Quellen
Pfarreiarchiv Wünnewil:
- 2.1.3.5 (4): Klassenarbeit der Abschlussklassen (7./8./9. Klasse) der Primarschule Wünnewil von Lehrer Oswald Schneuwly, Oktober 1968
Fussnoten
- Bundesarchiv Bern, Bericht von Willy Zeller vom 20. Dezember 1967 (BAR, J 2.301-01 2004/436, Bd. 61) ↩︎



